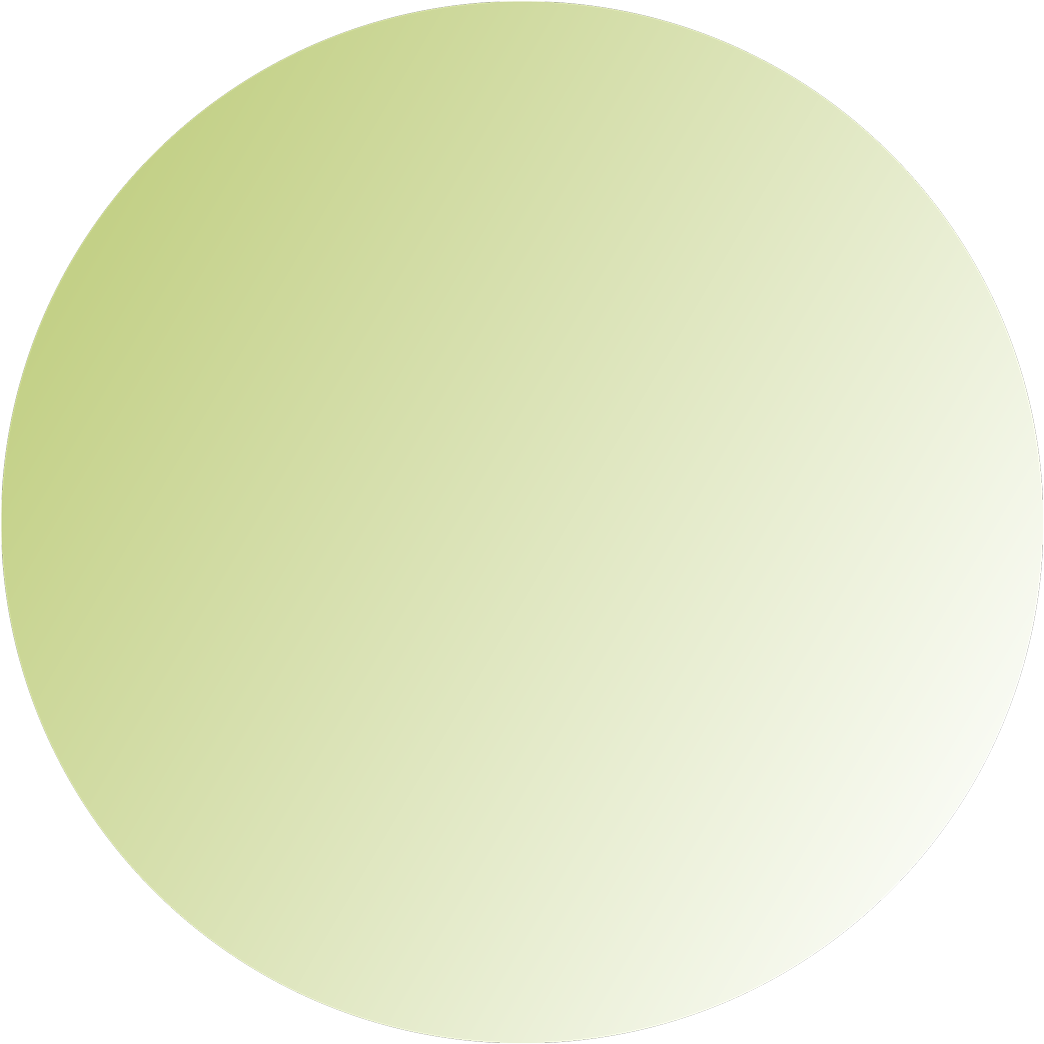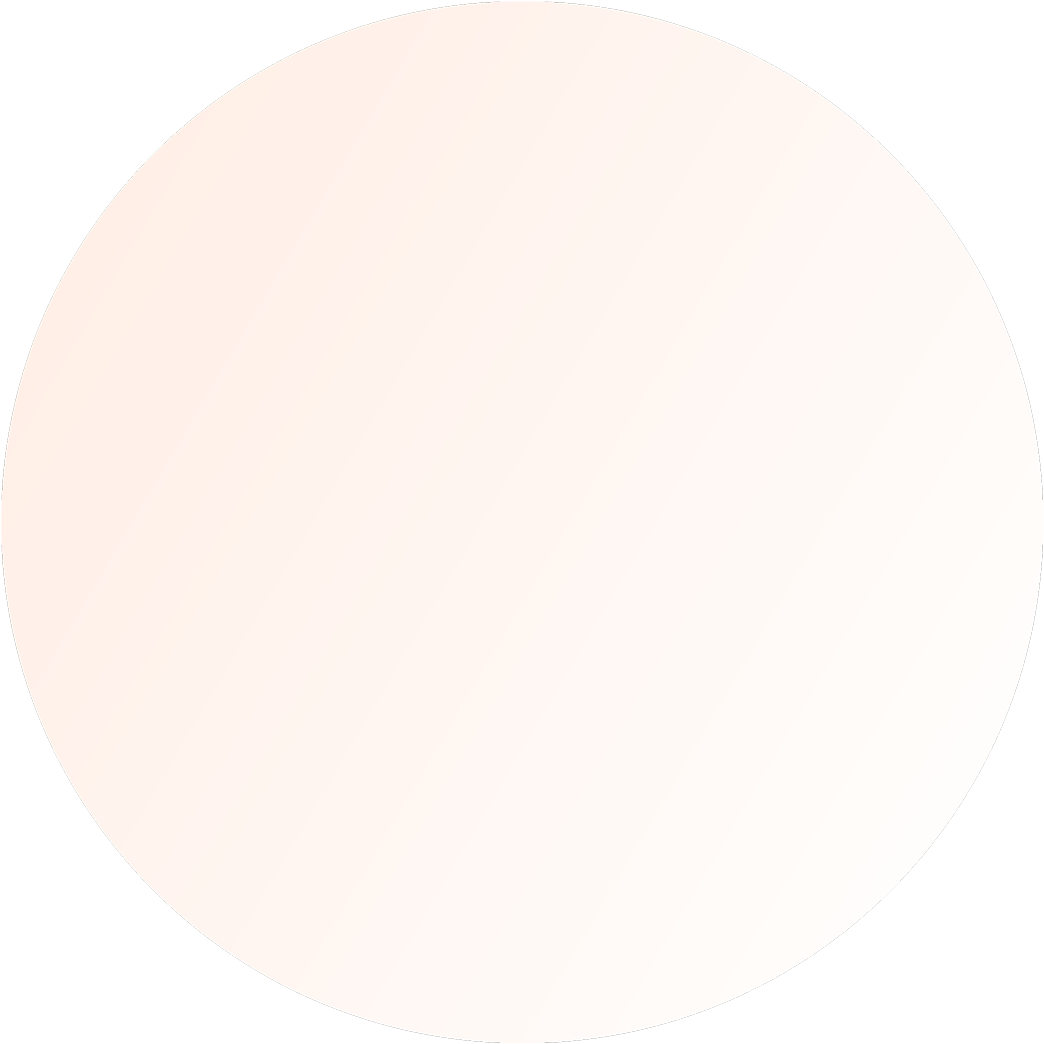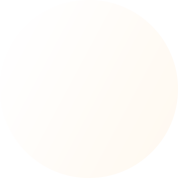Die Notwendigkeit einer kohärenten Explikation und philosophischen Verteidi-
gung und Begründung des Toleranzbegriffs scheint gegenwärtig mindestens so
dringlich wie zu Lessings Zeiten.
Zugleich hat sich die gesellschaftliche Situa-
tion im Hinblick auf den Pluralismus von Religionen und Weltanschauungen in
wichtigen Hinsichten gewandelt. – Im folgenden sollen beispielhaft einige Über-
legungen aus der in jüngerer Zeit intensiver geführten philosophischen Diskus-
sion um den Toleranzbegriff vorgestellt werden, die sich auf eine Fragestellung
konzentrieren. Die Schriften von John Rawls, Rainer Forst und Jürgen Habermas
lassen sich im Hinblick auf das Argumentationsziel lesen, zu plausibilisieren, dass
und wie begründet werden kann, dass es vernünftig und geboten ist, auf die
zwangsweise Durchsetzung und das öffentliche Verbindlichmachen bestimmter
Überzeugungen – mittelbar auch dadurch, dass allgemeine Gesetze durch diese
Überzeugungen begründet werden – zu verzichten, ohne dass dies zur Voraus-
setzung hätte, diese Überzeugungen als unwahr, unbegründet oder irrational
ansehen zu müssen.
Moderne Gesellschaften sind durch das „Faktum des Pluralismus“ (J. Rawls) ge-
prägt, d.h. durch eine dauerhafte Pluralität religiöser und säkular-weltanschau-
licher Lehren. Gegenüber der Situation zu Zeiten Lessings hat sich dieser für
moderne Gesellschaften charakteristische Pluralismus in mehrfacher Hinsicht
dramatisiert: So lässt sich der gegenwärtige Pluralismus nicht nur im Hinblick
auf eine nochmals gesteigerte Pluralität religiöser Orientierungen akzentuieren,
sondern zusätzlich im Hinblick auf die Tatsache, dass religiöse und säkulare oder
areligiöse Orientierungen dauerhaft koexistieren. Anders als eine Zeitlang durch
die klassische Säkularisierungstheorie unterstellt, scheint die Koexistenz religiö-
ser und nichtreligiöser Überzeugungssysteme ein dauerhaftes Merkmal der politi-
schen Kultur jeder liberalen Gesellschaft darzustellen. Dazu hat sich das Verständ-
nis dieser doppelten Pluralität nochmals gegenüber der Aufklärungsepoche in
entscheidender Hinsicht radikalisiert: Die Vorstellung, der religiöse Pluralismus sei
eine transitorische Erscheinung, da im Zuge der Selbstaufklärung des religiösen
Bewusstseins an die Stelle der geschichtlichen Pluralität der positiven Religionen
mehr oder weniger derselbe vernunftreligiöse Kerngehalt treten werde (eine Vor-
stellung, die viel stärker noch als Lessing dann Kant und Hegel vertreten haben),
ist mehr und mehr in den Hintergrund getreten und durch die Überzeugung von
einer selbst als vernünftig ausweisbaren Permanenz des gegenwärtigen Pluralis-
mus ersetzt worden. Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung, dass die
Begrenzung der Pluralität „umfassender Lehren“ (Rawls) nur um den Preis von
Repression und Gewalt erreicht werden kann, liest das moderne Bewusstsein an
der Gestalt des Pluralismus eine Struktureigenschaft der endlichen Vernunft ab.
Der Pluralismus religiös-weltanschaulicher Orientierungen ist danach weder his-
torisches Durchgangsstadium noch Ergebnis vermeidbarer Täuschungen und kor-
rigierbarer Irrtümer, sondern Ergebnis des „freien Vernunftgebrauchs“ (Rawls).
Die Haltung der Toleranz kann als eine angemessene Antwort auf die Heraus-
forderung des religiös-weltanschaulichen Pluralismus verstanden und verteidigt
werden. Hier lassen sich nun schon auf einer basalen Ebene zwei wesentlich
verschiedene Verständnisweisen von Toleranz unterscheiden: Die Haltung der To-
leranz lässt sich zum einen als eine Strategie des klugen, politisch-pragmatischen
Umgangs mit Konflikten verstehen, die etwa im Hinblick auf ein faktisch beste-
hendes Kräftegleichgewicht, in je konkreter Abwägung der vorhersehbaren Fol-
gen alternativer Handlungsoptionen oder aus bloß instrumentellen Gründen die
Akzeptanz der derzeitigen Unauflösbarkeit bestimmter Wertkonflikte im Sinne
eines modus vivendi versteht. Die Haltung der Toleranz lässt sich zum anderen
aber auch, und dieses zweite Verständnis soll im folgenden näher erläutert wer-
den, als eine selbst normativ ausgezeichnete und begründbare, deshalb nicht nur
instrumentell-kluge, sondern vernünftige Umgangsweise mit dem „Faktum des
Pluralismus“ verstehen.
Diese Unterscheidung zweier Verständnisweisen der Toleranz lässt sich näher er-
läutern durch eine Unterscheidung in bezug auf ihren Gegenstand, d.h. in bezug
auf diejenigen Überzeugungen, die als Kandidaten für Toleranz in frage kommen.
Tolerant sein heißt aus der Perspektive desjenigen, der Toleranz übt, Überzeugun-
gen zu tolerieren, die er selbst nicht teilt. Es kann sein, dass jemand bestimmte
Überzeugungen anderer nicht teilt, weil diese aus seiner Perspektive irrational,
nämlich evidenterweise, d.h. für jeden einsehbar falsch oder unmoralisch sind.
Auch solche Überzeugungen zu tolerieren kann in bestimmten Fällen angemes-
sen oder geboten sein – was aber im konkreten Fall unter Abwägung einer Reihe
von Gesichtspunkten (u.a. vordringlich der Frage, inwiefern sich auf diese Über-
zeugungen Handlungen gründen, die in Interessen Dritter eingreifen; inwiefern
die Autonomie von Lernprozessen geschützt werden muss usw.) zu klären ist.
Der aufschlussreichere Fall ist allerdings derjenige, wo jemand eine Überzeugung
nicht teilt – und er auch nicht rational verpflichtet wäre, diese Überzeugung zu
übernehmen, also seine eigene Überzeugung nicht unvernünftig ist – und gleich-
wohl die nichtgeteilte Überzeugung selbst nicht als irrational verstanden werden
kann.
Dass es solche Überzeugungen gibt, ist die epistemische „Entdeckung“, die
122
dem modernen normativen Konzept von Toleranz zugrunde liegt: Es gibt Über-
zeugungen und Überzeugungssysteme, von denen weder gezeigt werden kann,
dass es rational zwingend ist, sie zu übernehmen, noch dass es zwingend ist,
sie aufzugeben. Im Falle des Konfligierens dieser Art von Überzeugungen ist die
Rede von einem vernünftigen Dissens deshalb in besonderer Weise treffend. In
diesem Fall ist eine Haltung der Toleranz gegenüber konfligierenden Überzeu-
gungen grundsätzlich geboten. Das heißt beispielsweise allgemein in praktisch-
politischen Kontexten, dass eine Verpflichtung besteht, dass Handlungen – ins-
besondere Ausübungen staatlicher Zwangsgewalt – allen von ihnen Betroffenen
gegenüber in einer Begrifflichkeit und unter Rekurs auf Gründe gerechtfertigt
können werden müssen, die von allen Betroffenen gleichermaßen akzeptiert wer-
den können; und das heißt, dass solche Begründungen nicht zur Rechtfertigung
politischer Maßnahmen herangezogen werden dürfen, die nur für diejenigen
Bürger akzeptabel sind, die eine bestimmte religiöse oder auch säkulare „um-
fassende Lehre“ (Rawls) teilen. – Interessanterweise scheint gegenwärtig diese
„epistemische Entdeckung“ von zwei Seiten bedroht, nämlich nicht nur durch
einen religiösen, sondern gleichermaßen auch durch einen szientistischen Funda-
mentalismus. Der szientistische „Säkularist“ (so der Ausdruck von Habermas), der
behauptet, religiöse Überzeugungen seien falsch (die „Schlechte-Wissenschaft“-
Theorie der Religion) oder sie seien überhaupt sinnlos, bestreitet gleicherma-
ßen wie der religiöse Fundamentalist die für die epistemische Grundlegung des
Toleranzgedankens zentrale Annahme, dass die Disjunktion zwischen für jeden
rational zwingenden und irrationalen Überzeugungen nicht vollständig ist. Das
säkularistische Bewusstsein kann deshalb auch zwischen Glauben und Aberglau-
ben nicht unterscheiden. Toleranz kann hier gegenüber für irrational gehaltenen
Überzeugungen nur nach dem ersten, dem pragmatischen Folgenabschätzungs-
und modus vivendi-Modell verstanden werden. Toleranz ist dort grundiert durch
die paternalistische Haltung bloß bedingter Akzeptanz abweichender Überzeu-
gungen durch denjenigen, der eigentlich weiß, dass er es besser weiß, und dass
auch der andere es eigentlich besser wissen könnte und müsste. – Das zweite,
das nicht bloß pragmatische, sondern vernünftige Toleranz-Modell setzt dagegen
voraus, dass es den logischen Raum gibt für Überzeugungen, die weder einfach
irrational noch in einer bestimmten Gesellschaft allgemein akzeptabel sind.
Vor dem Hintergrund einer solchen Erläuterung kann der Toleranzbegriff in ver-
schiedenen Hinsichten präzisiert und gegen Einwände verteidigt werden. So
lautet ein üblicher – und vor allem auch in politischen Kontexten gern zitierter
– Einwand, der Begriff der Toleranz sei selbstwidersprüchlich oder sogar selbst-
destruktiv, weil er auf eine Haltung der Enthaltsamkeit gegenüber den Geltungs-
ansprüchen derjenigen Überzeugungen verpflichte, die unmittelbar denjenigen
Überzeugungen widersprächen, auf die sich die Haltung der Toleranz selbst grün-
de – auf diese Weise unterminiere sich die Toleranzidee selbst. Diesem Einwand
kann dadurch begegnet werden, dass verschiedene Reflexionsebenen, und damit
verschiedene Arten normativer Überzeugungen unterschieden werden. So kann
zwischen denjenigen Überzeugungen, zwischen denen ein vernünftigerweise
nicht aufzulösender Dissens besteht, und solchen Überzeugungen unterschieden
werden, die erläutern, weshalb die unaufgelöste, weil vielleicht unauflösbare
Konkurrenz einer bestimmten Art von Überzeugungen überhaupt das norma-
tive Prädikat ‚vernünftig‘ verdient. Die reflexive Einsicht in die (jedenfalls der-
zeitige) Unauflösbarkeit bestimmter Streitfragen liegt nicht auf der Ebene der
konfligierenden Überzeugungen selbst. – Wichtiger noch: Die Idee der Toleranz
beruht fundamental auf der moralischen Idee der Gleichheit aller Träger konkur-
rierender Überzeugungen. Allen Menschen kommt gleichermaßen ein „Recht auf
Rechtfertigung“ (R. Forst) zu. Diese moralische Grundüberzeugung verpflichtet
auf einen Grundsatz der kontextuell zu spezifizierenden Enthaltsamkeit, der es
verbietet, anderen gegenüber Handlungen, die sie betreffen, durch Überzeugun-
gen zu begründen, deren Rechtfertigung ausschließlich auf Gründen beruht, die
nicht allen gleichermaßen zugänglich sind. Dem Selbstwidersprüchlichkeits- oder
Selbstdestruktionseinwand gegen das Toleranzkonzept kann dadurch begegnet
werden, dass gezeigt wird, dass die moralische Überzeugung über die Gleichheit
der Träger der konkurrierenden weltanschaulich-religiösen Überzeugungen nicht
auf dergleichen Ebene wie diese konkurrierenden Überzeugungen selbst liegt,
sondern unabhängig von ihnen (Rawls: „freistehend“) begründet werden kann.
(Was im übrigen nicht ausschließt, dass diese moralische Grundüberzeugung
auch durch ‚umfassende‘, etwa religiöse Überzeugungen begründet werden
kann. Die Toleranz kann selbst auch ausdrücklich religiös begründet werden. Die
Widerlegung des Selbstwidersprüchlichkeitseinwand gegen das Toleranzkonzept
erfordert nicht zu behaupten, dass die dem Toleranzkonzept zugrundeliegende
moralische Grundüberzeugung nicht religiös begründet werden könnte, sie er-
fordert allerdings darauf zu bestehen, dass diese Grundüberzeugung nicht zwin-
gend religiös begründet werden muss.) Die Toleranzidee verpflichtet deshalb zur
Enthaltsamkeit in bezug auf die Beurteilung einiger, aber nicht aller Arten von
normativ gehaltvollen Überzeugungen.
Worauf verpflichtet die Toleranz in bezug auf diejenigen eigenen Überzeugun-
gen, die mit denen anderer konfligieren, ohne dass eine der konfligierenden Sei-
ten als für jeden einsehbar falsch oder unvernünftig verstanden werden könnte?
Insbesondere ist hier die Frage entscheidend, ob es das Konzept der Toleranz
gebietet, im Falle des Konfligierens die eigenen Überzeugungen aufzugeben oder
nicht mehr für wahr zu halten.
124
Das Toleranzkonzept bezieht sich auf die Erfahrung, dass es konkurrierende
Überzeugungen gibt, die als gleichermaßen „vernünftig“ und subjektiv begrün-
det verstanden werden können. Das Toleranzkonzept behauptet, dass zwischen
der Vernünftigkeit und dem Begründetsein von Überzeugungen einerseits, der
Frage nach der allgemeinen Akzeptabilität andererseits logisch-begrifflich unter-
schieden werden kann. Das heißt, dass es ohne Widerspruch möglich ist, eine
Überzeugung selbst für wahr und begründet zu halten und gleichwohl einzuse-
hen, dass diese Überzeugung nicht für jeden gleichermaßen akzeptabel ist und
deshalb etwa nicht zur Begründung einer alle betreffenden Gesetzgebung heran-
gezogen werden kann. Das heißt umgekehrt, dass die Haltung der Toleranz nicht
dazu zwingt, eigene Überzeugungen nicht mehr für begründet oder nicht mehr
für wahr zu halten. Die Haltung der Toleranz verpflichtet nicht darauf, eigene
(etwa religiöse) Überzeugungen, die nicht allgemein akzeptabel sind – weil sie
mit anderen Überzeugungen konfligieren, die gleichermaßen nicht einfach irrati-
onal sind – aufzugeben oder für unbegründet, irrational oder irrelevant zu halten.
Die Pointe dieses Toleranzverständnisses wird vor folgendem Hintergrund deut-
lich. Die Grundfrage der modern-liberalen Thematisierung des religiös-weltan-
schaulichen Pluralismus lautet: Wie können Bürger mit unterschiedlichen religi-
ös-weltanschaulichen Überzeugungen friedlich und in gegenseitigem Respekt
zusammenleben, d.h. ohne sich gegenseitig ihre jeweiligen Überzeugungen ver-
pflichtend machen zu wollen?
Die eine, eher ‚säkularistische‘ Antwort, die in der politischen Theorie darauf ge-
geben wurde, lautet: Das funktioniert nur dann, wenn die Religionen sich in einer
bestimmten Weise „depotenzieren“, also ihre eigenen Wahrheitsansprüche auf-
geben bzw. ihre Geltungsansprüche so (um-)interpretieren, dass diese gar nicht
mehr miteinander konfligieren. Das würde heißen, ein dauerhafter und stabiler
Pluralismus setzte eigentlich voraus, dass jede Religion aus sich eine Art spezi-
fisch liberale, „kulturprotestantische“ Variante entwickelte. Religiöse Wahrheits-
ansprüche und liberale Demokratie werden in dieser Perspektive als tendenziell
unvereinbar betrachtet. (So haben etwa, mit entgegengesetzter Bewertung, Hans
Kelsen und Carl Schmitt die These vertreten, die moderne Demokratie beruhe
letztlich auf einer relativistischen bzw. immanentistischen Weltanschauung.) Ge-
gen diese erste Antwort träten deshalb die Selbstwidersprüchlichkeitseinwände
wieder auf den Plan, die oben diskutiert wurden: Die Anerkennung der Legitimi-
tät des Pluralismus, die zur Toleranz gegenüber abweichenden Anschauungen
verpflichtet, beruhte auf einer selbst gehaltvollen und mit anderen konkurrieren-
den Weltanschauung. – Das oben vorgestellte Toleranzkonzept ist der Versuch,
diese Antwort gerade zu vermeiden. Die zweite Antwort auf die Frage, wozu die
Anerkennung des Pluralismus verpflichtet, besteht darin, zu erklären, dass und wie es möglich ist, dass sich etwa auch religiöse Bürger zur Legitimität des Plura-
lismus affirmativ verhalten können, ohne dass sie dies dazu zwingen würde, die
eigenen religiösen Wahrheitsansprüche aufzugeben. Die Affirmation einer libera-
len politischen Ordnung wird auf diesem Wege auch einem „exklusivistischen“ re-
ligiösen Selbstverständnis ermöglicht. Die normative Attraktivität dieser zweiten
rührt augenscheinlich aus den Problemen der ersten Antwort, die nämlich von
außen den Religionen inhaltlich die Ausbildung eines spezifischen Selbstverständ-
nisses vorschreibt. Der Kreis derjenigen Lehren und Anschauungen, die als legi-
time Teilnehmer am modernen Pluralismus akzeptiert werden, ist in diesem ers-
ten Modell deshalb erheblich eingeschränkt. Gegen diese erste „säkularistische“
Antwort ließe sich deshalb tatsächlich der Vorwurf der Selbstwidersprüchlichkeit
formulieren, da hier zur Bedingung der Toleranz eine Interpretation religiöser Gel-
tungsansprüche gemacht wird, die selbst vernünftigerweise umstritten ist. – Der
Prozess der Rationalisierung, als der sich die Modernisierung von Gesellschaften
verstehen lässt, ist vor allem als Prozess der zunehmenden Differenzierung von
Geltungsansprüchen beschrieben worden. Der moderne, nicht-paternalistische
Begriff von Toleranz beruht auf der Differenzierung zwischen dem Anspruch, ei-
gene Überzeugungen berechtigterweise für begründet und wahr halten zu kön-
nen, und dem Anspruch, die allgemeine Akzeptabilität dieser Überzeugungen
ausweisen zu können.
Das beschriebene, in einem allerdings spezifischen Sinn „liberal“ zu nennende
Modell der Akzeptanz eines ‚vernünftigen‘ Pluralismus bedarf jedoch einiger er-
gänzender Überlegungen, um dem Einwand zu begegnen, die Akzeptanz ab-
gelehnter Überzeugungen sei nur durch Indifferenz zu erreichen. Dies stimmt,
so wie dargestellt, im Hinblick auf die eigenen Überzeugungen nicht, aber es
stimmt auch im Hinblick auf die abgelehnten Überzeugungen nicht. Die Feststel-
lung, dass es in diesen Fällen nicht irrational ist, an den eigenen Überzeugungen
festzuhalten, entbindet nicht von einer inhaltlichen Auseinandersetzung auch
mit den abgelehnten Überzeugungen. Die Erfüllung des Kriteriums allgemeiner
Akzeptabilität kann in demokratischen Gesellschaften nur im demokratischen
Diskurs selbst festgestellt werden. – Die Toleranz ersetzt nicht die hermeneuti-
sche Anstrengung des Verstehens des anderen, sondern setzt sie vielmehr gerade
voraus. Toleranz setzt voraus, dass die abgelehnten Überzeugungen jedenfalls
insoweit verständlich geworden sind, als dass sich das Konfligieren der Über-
zeugungen überhaupt feststellen lässt. Toleranz ist dann dort erforderlich, wo
die Einsicht in Gründe nicht zu einem Teilen der Gründe, das Verstehen nicht zu
einem Einverständnis führt.
Jürgen Habermas hat in seinen neueren Schriften auf zwei wichtige Ergänzun-
gen in bezug auf das liberale Koexistenz-Modell des Pluralismus hingewiesen.
die sich aus diesen Überlegungen ergeben. Erstens besteht so etwas wie eine
wechselseitige Verpflichtung der Bürger gegeneinander, sich Artikulationshilfe zu
leisten, wenn bestimmte Überzeugungen in den öffentlichen Diskurs eingebracht
werden. Das hat seinen Grund zum einen in der Verpflichtung zur Inklusion aller
Bürger in den demokratischen Diskurs. Zum anderen aber, und das ist der darüber
hinaus gehende zweite Ergänzungspunkt, gibt es ein Interesse der Gesellschaft
im ganzen am Einbezug möglichst vieler, und insbesondere auch religiöser Über-
zeugungen, da die Gesellschaft selbst andernfalls „von möglichen Ressourcen der
Sinnstiftung abgeschnitten“ würde (Habermas). Gleichwohl gilt im Hinblick auf
diese Überzeugungen, dass in bezug auf die Begründung politischer Maßnahmen
eine Enthaltsamkeitspflicht weiterhin solange besteht, solange keine „Überset-
zung“ in eine allen Bürgern gleichermaßen zugängliche Sprache gelungen ist. Ins-
besondere in bioethischen Debatten hat sich gezeigt, dass es Fälle gibt, in denen
säkulare und andersgläubige Bürger in religiösen Beiträgen „eigene, manchmal
verschüttete Intuitionen wiedererkennen“ (Habermas). So darf nicht vergessen
werden, dass die Möglichkeit besteht, dass sich Überzeugungen auch entparti-
kularisieren lassen, wenn nämlich Rechtfertigungen und sie stützende Argumen-
te für diese Überzeugungen gefunden werden, die unabhängig von derjenigen
„umfassenden Lehre“ verständlich und akzeptabel sind, in deren Kontext diese
Überzeugungen ursprünglich gebildet worden sind.
Literatur:
Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie (1920/21)
Rainer Forst, Toleranz im Konflikt (2003)
Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion (2005)
John Rawls, Politischer Liberalismus (1993)
Carl Schmitt, Politische Theologie (1922)
Der Anstieg der Informationsflut droht die Kulturen soliden Wissens zu über-
spülen. Bildung hingegen schwimmt nicht mit, sondern sucht das Ufer. Nur der
Stand auf festem Grund und Boden gestattet, mit Urteil, Augenmaß und guten
Gründen auszuwählen und abzuwägen. Nur Bildung hilft uns, im mare magnum
des Wissbaren das Wissenswerte nicht zu verfehlen. Nicht zuletzt lehrt sie uns
zu wissen,was wir getrost übersehen dürfen. So erwerben wir uns Gelassenheit
und gewinnen die Ruhe, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Je mehr die
Informationen ausufern, desto mehr bedarf es der Bildung, die Deiche aufwirft
und Kanäle zieht.
Die „Spaß-“ und „Multioptionsgesellschaft“ wirbt mit der Devise, alles sei mög-
lich, alles zu haben – übrigens auch die Bildung. Wer aber nur Bildungsbrocken
schluckt, ist noch lange nicht gebildet! So wenig wie eine Katze, die einen Kana-
rienvogel gefressen hat, schon singen kann. Alles, was nur zu drei Vierteln ver-
standen ist, „verschmilzt nicht mit der Person des Lernenden, sondern bleibt ein
umgehängter Mantel ohne wirklichen Bildungswert“ (Ludwig Reiners). Das Mehr
an Möglichkeiten macht vorerst nur fahrig und nicht schon reicher. Nicht die Fülle
erfüllt, sondern die Kraft, sich das Zuträgliche anzueignen und das Förderliche
festzuhalten. Auch hier gilt: Wer viel haben kann, muss viel wählen. Doch die Fähigkeit zu wählen – das Echte vom Trug, Wertvolles vom Billigem, das Gediegene
vom Läppischen, Berechtigtes von Beliebigem zu unterscheiden – kann niemand
einfach haben, sie muss erworben werden. Je mehr Möglichkeiten wuchern, des-
to mehr bedarf es der Bildung, die Form und Fassung findet und wachsen lässt.
Der Mensch ist das Wesen, das nicht einfach lebt, sondern sein Leben führt.
Dafür bedarf er der maßgebenden Bilder und weither überlieferten Vor-Bilder, es
bedarf geprüfter Gedanken und verbürgter Vorstellungen, die ein Ziel setzen und
in Anspruch nehmen. Nur was uns fordert, bewegt uns auch. Und nur ein selbst-
bestimmtes Leben, „das zu denken gibt“ (Rüdiger Safranski), vermag seinerseits
vorbildlich zu sein. Bildung bringt auf den Weg dorthin. Echte Bildung ist immer
„Erfüllung und Antrieb zugleich, ist überall am Ziele und bleibt doch nirgends
rasten, ist ein Unterwegssein im Unendlichen, ein Mitschwingen im Universum,
ein Mitleben im Zeitlosen“ (Hermann Hesse).
Nicht zuletzt wird auf diesem Wege Widerstandsfähigkeit erworben gegenüber
den trivialen Verführungen durch Mode und Werbung und den allgegenwärti-
gen Denkzwängen, die von den Meinungsmedien ausgehen. Denn Bildung ist
vor allem auch dies: Arbeit an sich selber. Nicht was einer hat, kann, weiß oder
vorstellt, ist die Sache, um die es geht, sondern die Frage der Bildung ist, wer
einer ist. So ist, wer sich bildet, tätig, aus sich selbst das Beste zu machen. Er
verkümmert nicht in der Einfalt seiner Interessen, er entwickelt sie zur Vielfalt. Er
gewinnt Umfang, Übersicht und Hintergrund. Im besten Falle findet er zu dem
Schwergewicht, das uns – wie der Kiel das Boot – aufrecht gehen lässt. Bildung
ist die Antwort auf die Frage, worauf es eigentlich ankommt, was wahrhaft zählt
und letztlich bleibt, was Bestand, Geltung und Gültigkeit hat. Sie befreit aus
Beliebigkeit, Belanglosigkeit, Flüchtigkeit, aus dem bloßen Ablauf des Lebens.
Schule und Massenuniversität stehen derzeit in der Versuchung, ihren Bildungs-
auftrag als Ballast abzuwerfen, um als Ausbildungsstätten auf Touren zu kom-
men. Die Routen schreibt das ökonomische Kalkül vor: Nicht, was der Mensch
braucht, sondern welche Sorte Mensch gebraucht wird, ist hier das Kriterium.
Der Mensch wird fit gemacht für den Betrieb, Ausbildung ist Brauchbarmachung,
Zurichtung zur geldwerten Verwendbarkeit. Ausbildung aber ergänzt Bildung al-
lenfalls, vermag sie jedoch nie zu ersetzen.
Der Auftrag der Wissenschaft hieß einmal, zutage zu bringen; inzwischen hat sie
die ganze Welt ins kalte Licht des Labors getaucht, und unter den Menschen des
wissenschaftlichen Betriebes sind wenige, die innen hell wurden. Der Fortschritt
der Wissenschaften hat die große in kleine Welten zerlegt, in denen sich allenfalls
arbeiten, aber nicht leben lässt. Denn der Mensch lebt im Haus der Sprache, dort,
wo er verstanden wird, wenn er spricht, und versteht, was gesprochen wird.
Doch wo die Wissenschaften ihre Türme bauen, zerfällt die Sprache ins babyloni-
sche Gewirr spezialisierter Idiome. Bildung hingegen – eigentlich eine Art Heim-
weh, die Sehnsucht, überall zu Hause zu sein – haust nicht in Fächern, sie sucht
ihre Heimat unter Menschen, die Menschen verstehen und sich als Verstehende
untereinander verständigen.
Der Anstieg der Informationsflut droht die Kulturen soliden Wissens zu über-
spülen. Bildung hingegen schwimmt nicht mit, sondern sucht das Ufer. Nur der
Stand auf festem Grund und Boden gestattet, mit Urteil, Augenmaß und guten
Gründen auszuwählen und abzuwägen. Nur Bildung hilft uns, im mare magnum
des Wissbaren das Wissenswerte nicht zu verfehlen. Nicht zuletzt lehrt sie uns
zu wissen,was wir getrost übersehen dürfen. So erwerben wir uns Gelassenheit
und gewinnen die Ruhe, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Je mehr die
Informationen ausufern, desto mehr bedarf es der Bildung, die Deiche aufwirft
und Kanäle zieht.
Die „Spaß-“ und „Multioptionsgesellschaft“ wirbt mit der Devise, alles sei mög-
lich, alles zu haben – übrigens auch die Bildung. Wer aber nur Bildungsbrocken
schluckt, ist noch lange nicht gebildet! So wenig wie eine Katze, die einen Kana-
rienvogel gefressen hat, schon singen kann. Alles, was nur zu drei Vierteln ver-
standen ist, „verschmilzt nicht mit der Person des Lernenden, sondern bleibt ein
umgehängter Mantel ohne wirklichen Bildungswert“ (Ludwig Reiners). Das Mehr
an Möglichkeiten macht vorerst nur fahrig und nicht schon reicher. Nicht die Fülle
erfüllt, sondern die Kraft, sich das Zuträgliche anzueignen und das Förderliche
festzuhalten. Auch hier gilt: Wer viel haben kann, muss viel wählen. Doch die Fähigkeit zu wählen – das Echte vom Trug, Wertvolles vom Billigem, das Gediegene
vom Läppischen, Berechtigtes von Beliebigem zu unterscheiden – kann niemand
einfach haben, sie muss erworben werden. Je mehr Möglichkeiten wuchern, des-
to mehr bedarf es der Bildung, die Form und Fassung findet und wachsen lässt.
Der Mensch ist das Wesen, das nicht einfach lebt, sondern sein Leben führt.
Dafür bedarf er der maßgebenden Bilder und weither überlieferten Vor-Bilder, es
bedarf geprüfter Gedanken und verbürgter Vorstellungen, die ein Ziel setzen und
in Anspruch nehmen. Nur was uns fordert, bewegt uns auch. Und nur ein selbst-
bestimmtes Leben, „das zu denken gibt“ (Rüdiger Safranski), vermag seinerseits
vorbildlich zu sein. Bildung bringt auf den Weg dorthin. Echte Bildung ist immer
„Erfüllung und Antrieb zugleich, ist überall am Ziele und bleibt doch nirgends
rasten, ist ein Unterwegssein im Unendlichen, ein Mitschwingen im Universum,
ein Mitleben im Zeitlosen“ (Hermann Hesse).
Nicht zuletzt wird auf diesem Wege Widerstandsfähigkeit erworben gegenüber
den trivialen Verführungen durch Mode und Werbung und den allgegenwärti-
gen Denkzwängen, die von den Meinungsmedien ausgehen. Denn Bildung ist
vor allem auch dies: Arbeit an sich selber. Nicht was einer hat, kann, weiß oder
vorstellt, ist die Sache, um die es geht, sondern die Frage der Bildung ist, wer
einer ist. So ist, wer sich bildet, tätig, aus sich selbst das Beste zu machen. Er
verkümmert nicht in der Einfalt seiner Interessen, er entwickelt sie zur Vielfalt. Er
gewinnt Umfang, Übersicht und Hintergrund. Im besten Falle findet er zu dem
Schwergewicht, das uns – wie der Kiel das Boot – aufrecht gehen lässt. Bildung
ist die Antwort auf die Frage, worauf es eigentlich ankommt, was wahrhaft zählt
und letztlich bleibt, was Bestand, Geltung und Gültigkeit hat. Sie befreit aus
Beliebigkeit, Belanglosigkeit, Flüchtigkeit, aus dem bloßen Ablauf des Lebens.
Schule und Massenuniversität stehen derzeit in der Versuchung, ihren Bildungs-
auftrag als Ballast abzuwerfen, um als Ausbildungsstätten auf Touren zu kom-
men. Die Routen schreibt das ökonomische Kalkül vor: Nicht, was der Mensch
braucht, sondern welche Sorte Mensch gebraucht wird, ist hier das Kriterium.
Der Mensch wird fit gemacht für den Betrieb, Ausbildung ist Brauchbarmachung,
Zurichtung zur geldwerten Verwendbarkeit. Ausbildung aber ergänzt Bildung al-
lenfalls, vermag sie jedoch nie zu ersetzen.
Der Auftrag der Wissenschaft hieß einmal, zutage zu bringen; inzwischen hat sie
die ganze Welt ins kalte Licht des Labors getaucht, und unter den Menschen des
wissenschaftlichen Betriebes sind wenige, die innen hell wurden. Der Fortschritt
der Wissenschaften hat die große in kleine Welten zerlegt, in denen sich allenfalls
arbeiten, aber nicht leben lässt. Denn der Mensch lebt im Haus der Sprache, dort,
wo er verstanden wird, wenn er spricht, und versteht, was gesprochen wird.
Doch wo die Wissenschaften ihre Türme bauen, zerfällt die Sprache ins babyloni-
sche Gewirr spezialisierter Idiome. Bildung hingegen – eigentlich eine Art Heim-
weh, die Sehnsucht, überall zu Hause zu sein – haust nicht in Fächern, sie sucht
ihre Heimat unter Menschen, die Menschen verstehen und sich als Verstehende
untereinander verständigen.
Bildungsanstrengungen sind daher immer auch Investitionen in den Erhalt der
gesellschaftlichen Gesprächs- und Handlungsfähigkeit, die verloren geht, wenn
die Welt hinter den Bildern der Welt verschwindet.
Tschuang Tse, einer jener fernen Vertrauten aus dem Reich der Mitte und der
Weisheit, sagt uns: „Willst Du für ein Jahr voraus planen, so baue Reis. Willst Du
für ein Jahrzehnt vorausplanen, so pflanze Bäume. Willst Du für ein Jahrhundert
planen, so bilde Menschen.“
Vor 115 Jahren, im Oktober 1901, erschien das erste Vorlesungsverzeichnis der
Lessing Hochschule. Sehen wir uns um, nach 115 Jahren: Auch wir sind, und wir
sind auch das (Zwischen-)Ergebnis dieser 115jährigen Bildungsaussaat! Gerade
wenn wir nicht mit allem und jedem in uns und um uns zufrieden sind, sollten
wir bedenken, dass Zukunftsinvestitionen sich immer erst in der Zukunft loh-
nen! Werner Remmers hat als niedersächsischer Kultusminister einmal formuliert,
man müsse, was die Bildungspolitiker pflanzen, in Ruhe – eben wie eine Pflanze
– wachsen lassen. „Wir dürfen sie nicht alle vierzehn Tage ausbuddeln, um zu
sehen, welche Wurzeln sie geschlagen hat.“
Ein wenig von diesem unaufgeregten Zukunftsvertrauen wünschten wir uns auch
von jenen Berliner Bildungspolitikern, die nach dem vielleicht allzu kurzschlüssi-
gem Entzug der Förderung für die Lessing Hochschule im vergangenen Jahrzehnt
über künftige Unterstützungsmöglichkeiten für diese Hochschule werden neu zu
befinden haben.
Was weiß das Hauptstadt-Berlin der noch jungen Berliner Republik noch um das
einstige Kultur- und Bildungsjuwel in den eigenen Mauern? Um jenes „Berliner
Bildungsharvard“ (Joachim Kreutzkam), an dem alles gelehrt, gedacht und ge-
wirkt hat, was in den 20er und frühen 30er Jahren in deutscher Sprache und
Kultur Rang und Namen hatte: Albert Einstein, Max Scheler, C.G.Jung, Alfred
Adler, die Brüder Thomas und Heinrich Mann, George Bernard Shaw, Hermann
Hesse, Paul Löbe, Gustav Stresemann, Walter Rathenau und Theodor Heuss, Lise
Meitner und Helene Stöcker, Erwin Schrödinger und Max von Laue, Georg Simmel
und Werner Sombart, Romano Guardini und Paul Tillich, Ernst Troelsch, Gustav
Radbruch und Carl Heinrich Becker, aber auch Fritz Lang und Gustav Gründgens,
Stefan Zweig, Carl Zuckmayer, Max Reinhardt, Fritz Kortner, Wilhelm Furtwäng-
ler, Alfred Kerr und viele, viele andere mehr!
Wenn wir Namen aufzählen – unter ihnen nicht weniger als acht Nobelpreis-
träger! – , dann werden wir uns angesichts der Fülle jener, deren zu gedenken
wäre und die zu erwähnen sind, geradezu unvermeidlich rügbarer Unterlassun-
gen schuldig machen.
108
Ein Name allerdings darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: der
Name (und das Werk) jenes Mannes, ohne dessen Wirken für diese Hochschule
wir wohl keinen Anlass hätten, einer großen Vergangenheit zu gedenken und an
einer hoffentlich ebenso bedeutsamen Zukunft zu bauen. Ich spreche von jenem
legendären Direktor dieser Einrichtung, Ludwig Lewin, der die Lessing Hochschu-
le 1914, im Alter von 27 Jahren, übernahm und im Frühjahr 1933 von den Nazis
aus seinem Amt vertrieben wurde. In den 60er Jahren, nach ihrer Wiederbegrün-
dung durch Willy Brandt in den Jahren zwischen 1965 und 1967, stand Ludwig
Lewin noch einmal – bis zu seinem Tod 1967 – an der Spitze dieser Einrichtung
und versuchte an die großen Leistungen der Vergangenheit anzuschließen. Wir
werden Ludwig Lewin – dem ab 1914 das Aufblühen der Lessing Hochschule und
1965 bis 1967 auch ihre Wiederbelebung zu danken sind – in einer eigenen Ver-
anstaltung im Rahmen unserer geplanten Ringvorlesung zu den großen Lehrern
der Lessing Hochschule gedenken.
Die Philosophische Fakultät der Freien Universität Berlin führt in ihrer Laudatio
zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Ludwig Lewin im November 1967 aus:
Diese Ehrung ist „Dr. Ludwig Lewin (gewidmet), dem bedeutenden Mittler zwi-
schen Wissenschaft und Bildung, dem es in den Jahren zwischen 1914 und 1933
gelungen ist, die Berliner Lessing Hochschule zu einem geistigen Mittelpunkt
Berlins zu entwickeln, der in ihrem Kreis sowohl großen Gelehrten Berlins und
der gesamten deutschsprachigen Welt wie führenden Politikern seiner Zeit ein
Forum öffentlicher Wirkung gegeben hat“.
Von Anfang an so ehrgeizig wie zielbewusst und konsequent versuchte Ludwig
Lewin die Lessing Hochschule als „Podium der Eliten“ aus Wissenschaft, Philo-
sophie, Kunst, Wirtschaft, Religion und Politik zu etablieren. Der Plan ging auf:
schon bald wurde die neue Einrichtung zum Treffpunkt der damals maßgeblichen
Geister. Max Liebermann unterrichtete Aquarellmalerei, Tilla Durieux und Mary
Wigman lehrten Schauspiel und Tanz, Wilhelm Furtwängler und Hans Pfitzner
boten Kurse in Kompositionslehre an, der Mathematiker und Schachweltmeister
Emanuel Lasker dozierte über „Strategie im Krieg, im Spiel und in der Liebe“, die
Nobelpreisträger Max von Laue (Chemie) und Erwin Schrödinger (Mathematik)
schätzten die Bühne der Lessing Hochschule als Experimentierfeld für neue na-
turwissenschaftliche Denkansätze.
Albert Einstein formulierte 1928 auf einer seiner Berliner Werbereisen zugunsten
der Lessing Hochschule (die sich, damals wie heute, ohne nennenswerte finan-
zielle Unterstützung von öffentlicher und privater Seite in höchst prekärer Situ-
ation befand): „Wenn es diese Einrichtung nicht schon gäbe, müsste man sie
schleunigst erfinden“; und der Philosoph Max Scheler, neben George Bernard
Shaw einer der ersten großen Präsidenten der Lessing Hochschule, erklärte, in
großer Übereinstimmung mit Ludwig Lewin, zum Ziel dieser – von ihm schon so
genannten – „Bildungsuniversität“: Es gelte, „die großen Synthetiker der Epoche
zu versammeln und ihnen eine Bühne zu geben. Überhaupt müsse man den Typ
des „Zusammenhangswissenschaftlers“ und Generalisten fördern. Spezialisten,
die uns die Welt in immer kleinere Bestandteile zerlegten, gäbe es schon genug!
Der so unermüdlichen wie einfallsreichen Umtriebigkeit Ludwig Lewins ist es zu
danken, dass sich die neue Einrichtung schon bald zu einem geistigen, kulturellen
und politischen Zentrum entwickelte, von dem vielfältige Anregungen und Wir-
kungen jenseits enger Fächergrenzen ausgingen. Mit anderen Worten: Er hatte
das Wunder vollbracht, am Vorabend des Dritten Reiches, mitten im politisch und
ideologisch zerrissenen Berlin, eine Oase der Nachdenklichkeit und Toleranz zu
begründen, in der, jenseits staatlich verwalteter Wissensarbeit und -vermittlung
und unabhängig von kirchlicher und parteipolitischer Patronage, die drängenden
Fragen der Gegenwart bedacht und Möglichkeiten zukünftiger Lösung erörtert
werden konnten. „Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Lehre, politi-
scher Reflexion und künstlerischer Realisation in einer Institution (wurde) das
geistige Leben der 20er Jahre zugleich repräsentativ dargestellt und verantwort-
lich mitgestaltet.“(Willy Brandt, 1967)
Etwas Vergleichbares könnte und sollte vielleicht die Lessing Hochschule dieser
Tage wieder gelingen: ein Forum der vielgestaltiger gewordenen „Berliner Repu-
blik“ zu sein, Ansprechpartner für Politiker und politisch Interessierte, für Junge
und Alte, Bewahrer und Innovatoren, ein Forum, auf dem es immer wieder auch
zu bemerkenswerten Denk- und Debattenzwischenfällen kommt. Die Geschichte
der Lessing Hochschule ist nicht nur ein Stück Berliner Bildungsgeschichte, sie ist
ein Dokument der Geistesgeschichte der Weimarer Republik, und sie wird, das
wünschen wir der Jubilarin im 115. Jahr ihres Bestehens und im 50. Jahr ihrer
Wiederbegründung, sich mit kraftvoller Handschrift in die Annalen der Berliner
Republik einschreiben!
Anzumerken bleibt: Ludwig Lewin selbst wurde nicht müde, daran zu erinnern,
dass der Name Lessing kein Zufallsprodukt war, sondern Programm. Religions-
wissenschaftliche und religionsgeschichtliche Grundsatzfragen, zumal der Pro-
blemkreis religiös motivierter Gewalt und die spiegelbildliche Suche nach religi-
öser Toleranz und Überwindung der Gegensätze gehörten von Anfang an zum
Kernbestand der Themen und Debatten an der Lessing Hochschule. An diese Tra-
ditionslinie schließen nicht zuletzt auch aktuelle Bemühungen an, an dieser Ein-
richtung – gerade auch unter dem Eindruck der jüngsten Migrations- und Flücht-
lingserfahrung – ein eigenes „Zentrum für Toleranzforschung“ zu etablieren.
Die Gründer und Förderer der Lessing Hochschule hatten ein hellsichtiges Auge
für die gänzlich vorbildlosen Bedürfnisse lebenslangen Lernens und Sich-Fort-
bildens in einer „immer schneller werdenden Zivilisation“. Es ging ihnen damals
(und geht uns heute!) nicht nur um die Befriedigung individueller Bildungswün-
111
sche, nicht nur um akademische Bildungsauffrischung einer gesellschaftlichen Eli-
te. So wichtig und legitim die individuelle Bereicherung und das „Bildungsglück“
des einzelnen gewiss auch sind – noch wichtiger ist das „soziale Kapital“, welches
sich durch Begriff und Sache der „Erwachsenenbildung“ und des „lebenslangen
Lernens“ erschließt